Urlaubszeit - Ihre Rechte auf einen Blick
- Irene Schuster

- 1. Juli 2025
- 2 Min. Lesezeit
Nachdem wir uns im letzten Beitrag mit den Grundlagen des österreichischen Urlaubsgesetzes (UrlG) beschäftigt haben, lohnt sich ein genauerer Blick auf die praktische Anwendung. Denn gerade in der Personalverrechnung, der Beratung oder als Arbeitgeber:in sind fundierte Kenntnisse über den Urlaubsanspruch unerlässlich.
Das Urlaubsgesetz spricht grundsätzlich vom Arbeitsjahr – also jenem Zeitraum, der mit dem Beginn des Dienstverhältnisses startet. In vielen Betrieben wird jedoch auf das Kalenderjahr umgestellt, oft über Kollektivverträge oder Betriebsvereinbarungen. Dabei ist zu beachten, dass dieser Wechsel keine Nachteile für Arbeitnehmer:innen mit sich bringen darf, etwa durch eine Verkürzung des Anspruchs oder des Bezugszeitraums.
Der Urlaubsverbrauch bedarf immer der beiderseitigen Vereinbarung. Weder Arbeitnehmer:innen noch Arbeitgeber:innen können den Urlaub einseitig festlegen. Dennoch ist es Arbeitgeber:innen erlaubt, Urlaubsanträge aus betrieblichen Gründen abzulehnen – beispielsweise bei Personalengpässen, Saisongeschäft oder projektbezogenen Verpflichtungen. Auf der anderen Seite dürfen Urlaubswünsche nicht grundlos verweigert werden. Ein fairer, geplanter Umgang mit Urlaub trägt zur Zufriedenheit im Unternehmen bei.
Was viele nicht wissen: Urlaubsansprüche verjähren. Wenn der Urlaub nicht innerhalb von zwei Jahren nach dem Ende des Urlaubsjahres konsumiert wird, kann er – sofern keine besonderen Umstände vorliegen – verfallen. Ausnahmen gelten etwa bei Langzeitkrankenständen oder bei einer objektiven Verhinderung, den Urlaub zu nehmen. Es empfiehlt sich daher, Urlaube nicht endlos aufzuschieben.
Endet ein Dienstverhältnis und es bestehen noch offene Urlaubsansprüche, so sind diese finanziell abzugelten – man spricht in diesem Fall von der Urlaubsersatzleistung. Diese wird auf Basis des laufenden Entgelts berechnet und umfasst auch anteilige Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
Auch bei Teilzeitbeschäftigungen besteht grundsätzlich ein voller Urlaubsanspruch, der jedoch anteilig an die vereinbarte Arbeitszeit angepasst wird. Während einer Karenz ruht das Arbeitsverhältnis, daher entsteht in dieser Zeit kein neuer Urlaub. Der nicht konsumierte Urlaub vor Beginn der Karenz bleibt jedoch bestehen und kann nach der Rückkehr in Anspruch genommen werden. Für Sonderformen wie Bildungskarenz oder Bildungsteilzeit gelten wiederum eigene Regelungen, die im Detail geprüft werden sollten.
In der Praxis zeigt sich immer wieder: Urlaub ist mehr als ein gesetzlicher Anspruch – er ist ein zentrales Instrument zur Erholung, zur Sicherung der Gesundheit und zur Bindung von Mitarbeiter:innen. Eine transparente Urlaubsplanung, klare Kommunikation und ein professioneller Umgang mit Sonderfällen schaffen Vertrauen und Rechtsklarheit.
Wer sich im Detail absichern möchte, sollte einen Blick ins Urlaubsgesetz (UrlG), in den anzuwendenden Kollektivvertrag und gegebenenfalls in betriebsinterne Regelungen werfen. So gelingt der Spagat zwischen Erholung und betrieblicher Organisation nachhaltig und rechtssicher.


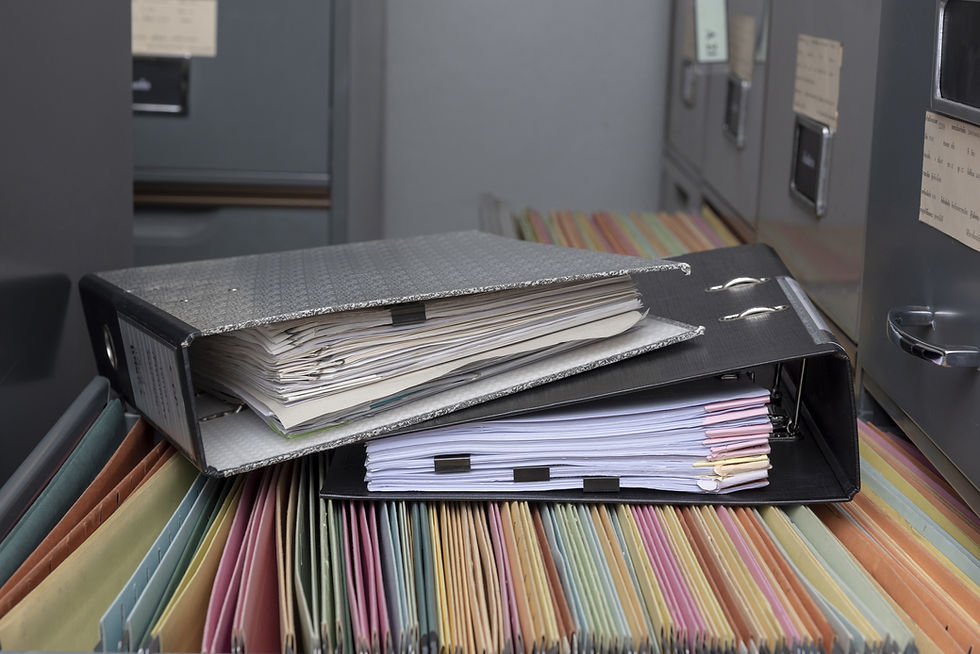
Kommentare